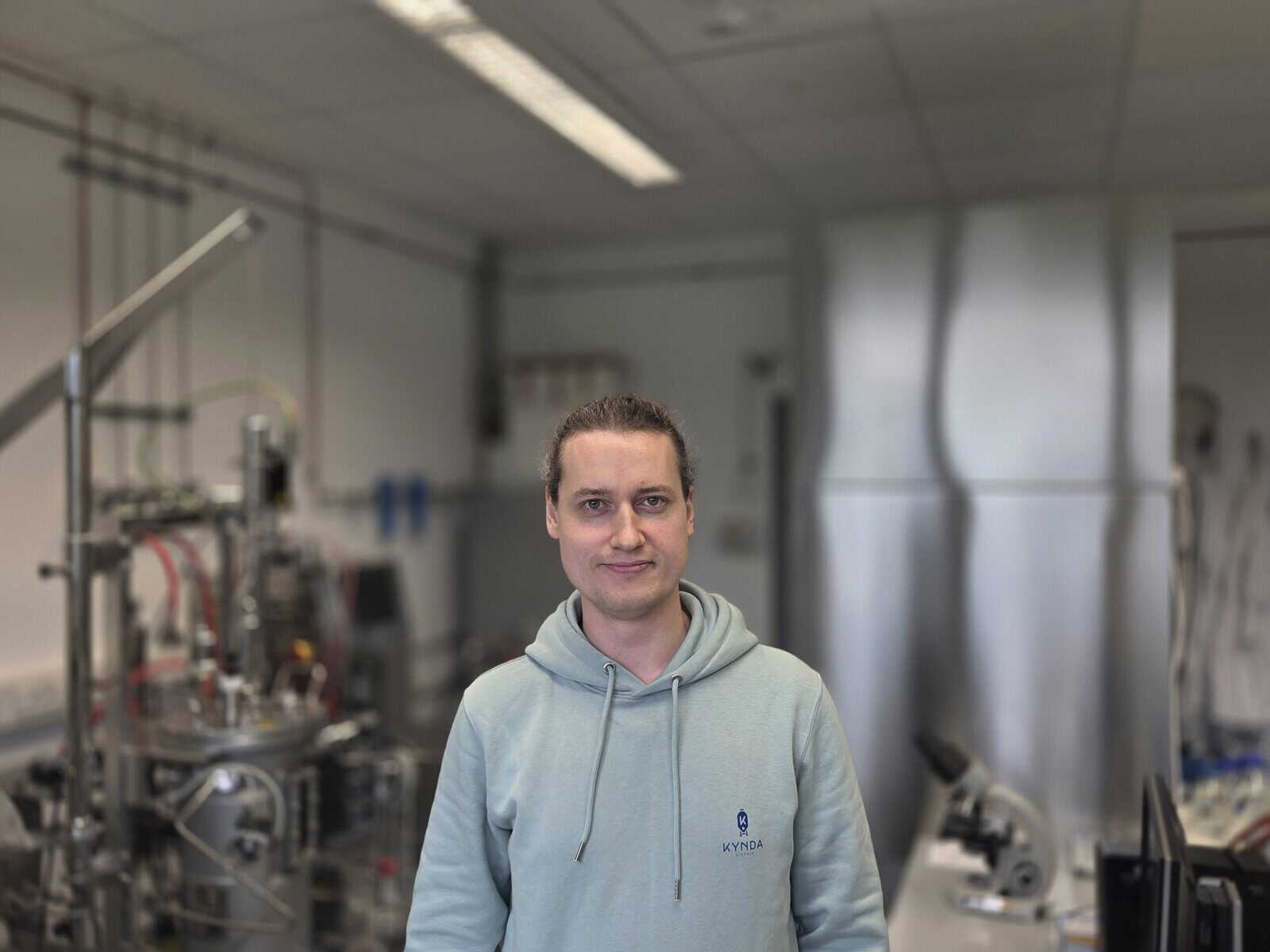Zwei Jahre lang haben drei Forschungseinrichtungen und ein Unternehmen am Projekt CELLZERO Meat gearbeitet. Im Dezember 2024 konnte es erfolgreich abgeschlossen werden: Der Plan, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem ein Produkt aus kultivierten Schweinezellen entsteht, ist geglückt. Doch das ist nicht alles: Die Ziele, keine Gentechnik zu nutzen und ohne fetales Kälberserum (FKS) auszukommen, wurden ebenfalls erreicht. Auch für Antibiotika hat das Projekt-Team einen Ersatz gefunden: Kaltes Plasma. Die als Ausgangsmaterial verwendeten Zellen stammen aus der Nabenschnur von Ferkeln. Vorteil: Das Material kann ohne schmerzhafte und aufwendige Prozeduren, wie Biopsien, in landwirtschaftlichen Betrieben gewonnen werden
Beteiligt waren das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern), die Hochschule Anhalt in Bernburg (Sachsen-Anhalt) sowie die PAN-Biotech GmbH in Aidenbach (Bayern). Die Hauptverantwortung trug das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock. CELLZERO Meat wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert.
Koordinatorin des Projekts war die Wissenschaftlerin und studierte Tierärztin Dr. habil. Monika Röntgen, die am FBN der Arbeitsgruppe Zellbiologie des Muskelwachstums vorsteht und bereits seit 2018 zu zellbasiertem Fleisch forscht. Im Interview mit uns spricht sie darüber, warum es ihr wichtig war, ohne Gentechnik zu arbeiten, weshalb sie die Zellen aus dem Nabelschnurgewebe für besonders geeignet hält und unter welchen Bedingungen kultiviertes Fleisch gesünder sein kann als herkömmliches Fleisch.
Ziel des Projekts CELLZERO Meat war es, kultiviertes Fleisch ohne Gentechnik, Kälberserum, Antibiotikum und Biopsien herzustellen. Warum war es Ihnen wichtig, ohne Gentechnik zu arbeiten? Weil Sie selbst skeptisch sind, was das anbelangt, oder weil durch Gentechnik die Akzeptanz der Verbraucher schwindet?
Ich selbst bin weniger skeptisch, da es inzwischen Methoden gibt, die aus meiner Sicht keine negativen Auswirkungen haben. Es geht mir tatsächlich eher darum, potenzielle Verbraucher nicht abzuschrecken und den Zulassungsprozess für zukünftige Produkte zu vereinfachen. Deshalb wollen wir so natürlich wie möglich arbeiten und vor allem das große Potential unserer Zellen nutzen.
Parallel setzen wir auf Spontanmutationen zur Entwicklung von immortalisierten Zelllinien. Hiermit hatten wir bereits einen ersten Erfolg und konnten eine porcine Zelllinie – also eine Zelllinie, die auf Zellen vom Schwein basiert – etablieren, die zur Produktion von kultiviertem Fett geeignet ist.

Statt Antibiotika wurde kaltes Plasma verwendet. Können Sie kurz erklären, wie man sich dieses kalte Plasma vorstellen kann? Und können dadurch keine resistenten Bakterien entstehen?
Plasma ist ein besonderer Zustand der Materie. Es wird neben fest, flüssig und gasförmig oft als vierter Aggregatzustand bezeichnet. Es enthält unter anderem elektrisch geladene Teilchen: Ionen und Elektronen. Kaltes Plasma ist ein nur teilweise ionisiertes Gas mit niedriger Energie, das ionisierte Moleküle, freie Elektronen und reaktive chemische Spezies enthält. In diesem Zustand beeinflussen sich die Teilchen gegenseitig durch ihre elektrischen Eigenschaften.
Um kaltes Plasma zu erzeugen, braucht man spezielle Geräte. Diese verwenden normale Luft (oder häufig Edelgase) und Energie. Das so erzeugte kalte Plasma enthält reaktive Stoffe, die Bakterien abtöten können. Der Vorteil ist, dass dabei keine schädlichen Rückstände entstehen und Bakterien keine Resistenzen entwickeln können. Durch die Erzeugung von Plasma an oder in Flüssigkeiten entstehen plasmaaktivierte Lösungen, insbesondere plasmaaktiviertes Wasser. Die Lösung kann vergossen, versprüht oder vernebelt werden und ist auch zum Reinigen von Anlagen und Flächen geeignet.
Unser Ziel ist es, Nabelschnurgewebe vom Schwein am Anfang des Herstellungsprozesses mittels plasmaaktivierter Lösungen keimfrei zu machen um im nachfolgenden Prozess ohne Antibiotika arbeiten zu können. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Einstellungen zu finden, um nur die Bakterien abzutöten, aber die gewünschten Zellen am Leben zu erhalten. Diese Aufgabe wurde erfolgreich am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald gelöst.
Sie verwenden, unter anderem um Biopsien zu vermeiden, Zellen aus dem Nabelschnurgewebe von Ferkeln. Sind die Zellen im Nabelschnurgewebe genauso gut wie solche, die zum Beispiel aus Biopsien gewonnen werden? Oder muss man da Abstriche machen?
Wir halten diese Zellen sogar für besonders geeignet – und das aus mehreren Gründen. Zunächst einmal sind für die Gewinnung des Nabelschnurgewebes keine Biopsien nötig, die für mich in diesem Zusammenhang auch nicht ethisch vertretbar wären. Es handelt sich um kleine Operationen, die das Gewebe schädigen und für das Tier, trotz lokaler Betäubung nicht zu 100 Prozent schmerzfrei sind. Deshalb sind Biopsien genehmigungspflichtig und es gibt klare Beschränkungen hinsichtlich der Gewebemenge und der Häufigkeit der Entnahme am Einzeltier. Mit unserem Vorgehen erreichen wir eine höhere Zellausbeute bei hoher Qualität der Zellen.
Unsere Nabelschnur-Zellen haben aber noch mehr Vorteile. Sie gehören zu den sogenannten mesenchymale Stammzellen, weisen aber eine einzigartige Mischung der Eigenschaften von echten Stammzellen (zum Beispiel embryonalen Stammzellen) und adulten Stammzellen (zum Beispiel Satellitenzellen im Muskelgewebe) auf. Sie sind multipotent, was bedeutet, dass sie in verschiedene Zelltypen, insbesondere auch in Muskel-, Fett- und Bindegewebszellen differenziert werden können. Zudem verfügen sie über eine lange Proliferationsfähigkeit. Sie können sich also über einen langen Zeitraum hinweg wiederholt teilen und neue Zellen bilden, bleiben dabei aber genetisch stabil.
Und das ist noch nicht alles: Weil es sich um Zellen von jungen Tieren handelt, waren sie noch keinen Umwelteinflüssen ausgesetzt und weisen dementsprechend auch keine Schädigungen, zum Beispiel durch Umwelttoxine, auf. Aufgrund all dieser Eigenschaften denke ich, dass Nabelschnurzellen, bei Nutzung von Primärzellen, zu den am besten für die Herstellung von kultiviertem Fleisch geeigneten Zelltypen gehören.

Zellkultivierung ohne Gentechnik, Kälberserum (FKS), Antibiotikum und Biopsien – welcher Teil davon war am schwierigsten umzusetzen?
Der Ersatz des fetalen Kälberserums (FKS) erwies und erweist sich als besonders komplex. Um möglichst schnell FKS-frei zu werden, haben wir in einem ersten Schritt Blutprodukte wie Schweineserum und Plättchenlysat entwickelt. Insbesondere Plättchenlysat, das aus Blutplättchen (Blutzellen, die an der Blutgerinnung beteiligt sind), hergestellt wird, enthält sehr viele wichtige Wachstumsfaktoren. Es wird deshalb auch für die humane Zellkultur als Ersatz für FKS empfohlen. Im nächsten Schritt, beziehungsweise parallel dazu, haben wir an der Entwicklung von Medien gearbeitet, die kein tierisches Serum enthalten. Hierbei haben wir „vegane“ Wachstumsfaktoren getestet und uns auf die Entwicklung weiterer Zusätze konzentriert, die das Serumalbumin ersetzen sollen.
Serumalbumin ist für serumfreie Medien unbedingt notwendig, da es mehrere wichtige Funktionen erfüllt. Es trägt zur Erhaltung der osmotischen Balance bei, wirkt als Puffersubstanz zur Stabilisierung des pH-Wertes und ersetzt für die Zellen teilweise die extrazelluläre Matrix. Diese Matrix ist wie eine Art Gerüst zwischen den Zellen, die dem Gewebe unter anderem ihre Form und Festigkeit gibt.
Unser Industriepartner, PAN Biotech, hat darüber hinaus ein für unseren Zelltyp angepasstes chemisch definiertes Nährmedium für die Zellproliferation entwickelt und in Langzeitversuchen positiv getestet.
Wichtig ist bei allen Medienentwicklungen, dass die Effizienz nicht leidet und die Kosten gesenkt werden. Deshalb ist unsere Arbeit noch nicht beendet: Aktuell liegt unser Fokus verstärkt auf der Erforschung pflanzlicher Alternativen, um tierische Produkte in der Zellkultur vollständig zu ersetzen.
Gab es während des Projekts Erkenntnisse, die Sie überrascht haben?
Es verwundert mich, dass mir oft gesagt wird, die Forschung zu kultiviertem Fleisch mache keinen Sinn, weil schon alles bekannt ist. Es gibt meiner Meinung nach noch so viele wissenschaftliche Fragestellungen. Für unseren Zelltyp gibt es zum Beispiel nur wenige Protokolle für die myogene Differenzierung. Das heißt, es werden in der Literatur nur sehr wenige und meist für die Lebensmittelproduktion ungeeignete Verfahren beschrieben, um aus Nabelschnurzellen spezialisierten Muskelzellen, sprich adulte Muskelfasern, zu erzeugen. Umso erfreuter bin ich, dass die Methode, die wir uns theoretisch überlegt haben, tatsächlich funktioniert.
Etwas überraschend im positiven Sinn war zudem, dass wir innerhalb sehr kurzer Zeit einen ausgefeilten und sehr effektiven Weg zur Erzeugung von kultiviertem Fett entwickelt haben.

Wie kann man dieses kultivierte Fett verarbeiten?
Für kultiviertes Fleisch ist das Fett essentiell, denn es ist unter anderem Geschmacksträger, beeinflusst das Geruchsprofil, die Farbe, die Textur und ist für das typische Mundgefühl verantwortlich. Dadurch kann eine große Ähnlichkeit zu konventionellem Fleisch erreicht werden, was den Konsumenten wichtig ist. Auch die Produktqualität, zum Beispiel der Gehalt an gesättigten beziehungsweise ungesättigten Fettsäuren, fettlöslichen Vitaminen (A, D, E und K) und Mineralstoffen (Eisen, Zink, Selen), hängt von der Fettkomponente im Fleisch ab.
Wir haben unser kultiviertes Fett dazu genutzt, ein sogenanntes Hybridprodukt herzustellen. Als pflanzliche Basis haben wir ein hochwertiges Sojamehl verwendet und neben unserem kultivierten Fett, Gemüse und Gewürze eingesetzt. Die zeigt, dass ethisch und nachhaltig produziertes tierisches Fett auch für Hersteller von pflanzlichen Alternativen interessant ist.
In der Lebensmittelindustrie spielt tierisches Fett auch aufgrund seiner funktionellen Eigenschaften eine Rolle, die pflanzliche Alternativen oder Substitute nur bedingt ersetzen können. Hinzu kommt, dass viele der pflanzlichen Fette importiert werden. Das macht sie, ähnlich wie konventionell produzierte tierische Fette nicht gerade nachhaltig.
Sind Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Projekt für die freie Wirtschaft zugänglich?
Wir haben bisher ein Arbeitgeber-Patent eingereicht, von dem wir gerade erfahren haben, dass es kurz vor der Anerkennung steht. Da wir die Ergebnisse selbst verwerten wollen, halten wir unser spezielles Know-how, insbesondere zur Differenzierung unserer Zellen in Muskelfasern und Fett geheim, sind aber interessiert an Partnerschaften, die dem gegenseitigen Vorteil dienen. Jetzt, nach Abschluss des Projekts, werden wir aber auch zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel zum Einfrieren von Geweben oder Verfahren zur Zellisolierung, publizieren.
Das Projekt CELLZERO Meat ist nun abgeschlossen. Wie geht es jetzt weiter?Arbeiten die beteiligten Einrichtungen und das Unternehmen weiter zusammen am Thema? Gibt es ein neues Projekt?
Wir arbeiten daran, die Voraussetzungen für die Gründung eines Unternehmens weiter herzustellen. Wir suchen dabei insbesondere neue Wege der Finanzierung sowie strategische Partnerschaften und potenzielle Kunden beziehungsweise Interessenten für unsere Verfahren und Produkte. Im Ergebnis des Projektes haben wir einen sehr guten Prozess zur Herstellung von kultiviertem Fett und erste Produktprototypen entwickelt.

Inwiefern sind die Erkenntnisse aus dem Projekt CELLZERO Meat auf andere Tierarten übertragbar? Kann man Ihr Verfahren beispielsweise auch bei Rindern und Geflügel anwenden?
Unser Verfahren ist bei allen Säugetieren anwendbar. Natürlich ist mit tierartspezifischen Besonderheiten, besonders bei Wiederkäuern, zu rechnen. Generell müssen Nährmedien – zum Beispiel die Wachstumsfaktoren und deren Konzentration – immer auch auf die Spezies abgestimmt werden. Beim Geflügel würde ich, obwohl es auch hier ähnliche Strukturen wie die Nabelschnur gibt, eher auf Zelllinien setzen.
Befürworter von kultiviertem Fleisch meinen, dass es gesünder sein kann als herkömmliches Fleisch. Wie schätzen Sie das ein?
Ich stehe da auf der Seite der Befürworter und bin selbst daran interessiert, die Entwicklung von Nährmedien voranzutreiben, die solche positiven gesundheitlichen Wirkungen ermöglichen. Durch gezielte Anpassungen der Nährstoffzusammensetzung kann beispielsweise das Fettsäuremuster oder der Vitamin- und Mineralstoffgehalt im kultivierten Fleisch optimiert werden, was gesundheitliche Vorteile mit sich bringen könnte. Ein Ansatz wäre etwa die Integration von Alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure), die zur Erhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beiträgt und auch die normale Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen unterstützt.
Kritiker von Kulturfleisch vermuten, dass kultiviertes Fleisch niemals in großem Maßstab gezüchtet werden kann, weil immer Keime wie Bakterien in die Nährmedien gelangen und man dann statt Fleisch nur massenhaft Bakterien züchtet. Wie sehen Sie das?
Die Bedenken der Kritiker, dass kultiviertes Fleisch nicht in großem Maßstab gezüchtet werden kann, halte ich für unbegründet. Diese Meinung kommt vermutlich von Menschen, die keine praktische Erfahrung mit Zellkulturen haben. Tatsächlich wäre ohne die Möglichkeit, auch in großem Maßstab steril zu arbeiten, weder eine Zellkultur noch deren Anwendung in Biotechnologie und Pharmazie möglich.
Zwar wird es mit steigendem Produktionsvolumen schwieriger, Sterilität zu gewährleisten, aber dafür gibt es bewährte Methoden. Besonders hilfreich sind dabei die Entwicklung von geschlossenen Medienkreisläufen und kontinuierlichen Herstellungsprozessen. Diese senken das Kontaminationsrisiko deutlich. Auch der schrittweise Ersatz oder die Vermeidung tierischer Bestandteile – wie fetales Kälberserum, Enzyme tierischen Ursprungs und Serumalbumin – tragen dazu bei, das Risiko signifikant zu verringern.
Was halten Sie von der teilweise geäußerten Kritik, das kultiviertes Fleisch „unnatürlich“ sei?
Auch davon halte ich nichts. Unser Körper besteht aus Zellen, das Nährmedium ähnelt dem Blut beziehungsweise der Gewebeflüssigkeit – das Ausgangsmaterial ist also biologisch und damit natürlich.

Wann sind Sie zum ersten Mal auf das Thema kultiviertes Fleisch aufmerksam geworden?
Bereits 2014 bin ich im Zusammenhang mit unserer Forschungsarbeit zur frühpostnatalen Muskelentwicklung beim Schwein auf das Thema gestoßen. Uns interessierte hauptsächlich die Rolle der Stammzellen, das heißt der Satellitenzellen, und ich wollte für Experimente auch Bioprinting einsetzen. Bioprinting ist ein spezieller 3D-Druckprozess, bei dem lebende Zellen und biologische Materialien Schicht für Schicht zu Gewebe oder organähnlichen Strukturen verarbeitet werden.
Auf einer Startup-Messe habe ich dann einen der Gründer des niederländischen Unternehmens Meatable kennengelernt: Daan Luining. Aus einem Gespräch ergab sich eine Einladung nach Dummerstorf, ein begeisternder Vortrag von Daan zu kultiviertem Fleisch sowie Unterstützung von unserer Seite bei der Beschaffung von Schweinezellen aus Nabelschnurblut. Das Verfahren von Meatable gehört heute zu den erfolgreichsten und nutzt induzierte pluripotente Stammzellen, das heißt reprogrammierte Zellen.
Wir setzen hingegen auf Primärzellen, die direkt aus dem Gewebe gewonnen werden, weil wir so natürlich wie möglich produzieren und mit Landwirten, zunächst hinsichtlich der Rohmaterialgewinnung, zusammenarbeiten möchten. Wie bereits beschrieben, erhoffen wir uns davon auch positive Effekte auf die Verbraucherakzeptanz und eine Vereinfachung der Zulassung für unsere Produkte.
Was glauben Sie: Wird kultiviertes Fleisch irgendwann einen großen Teil der menschlichen Ernährung ausmachen?
Ich denke, dass Lebensmittel in Zukunft grundsächlich nachhaltiger hergestellt werden müssen. Dazu gehört auch, den Fleischkonsum zu reduzieren und Alternativen beziehungsweise neue Technologien und Wertschöpfungsketten zu entwickeln. Wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte gesehen und es wurde gezeigt, dass die Technologie umsetzbar ist. Cultivated Meat kann meiner Meinung nach einen wesentlichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten, weil dadurch die Tierzahlen der konventionellen Produktion reduziert werden können.
Aus meiner Sicht wird kultiviertes Fleisch, sobald es großtechnisch und nachhaltig produziert werden kann, einen größeren Teil des Alltagsbedarfs decken. Nach aktuellen Prognosen könnte dies ab 2030 für einfache Produkte und ab 2035 für komplexere Produkte der Fall sein. Kultiviertes Fleisch wird dabei nicht nur als eigenständiges Produkt eine Rolle spielen. Kultiviertes tierisches Protein und Fett können auch in Form von Hybridprodukten oder als Zutat in pflanzenbasierten Lebensmitteln verwendet werden, beispielsweise zur Geschmacksverbesserung durch kultiviertes Fett.
Gleichzeitig wird jedoch ein Teil der Fleischproduktion weiterhin mit Tieren erfolgen. Ich sehe in kultiviertem Fleisch aber auch eine Chance, die Tierhaltung insgesamt zu verändern. Durch reduzierte Tierbestände und die mögliche Beteiligung von Landwirten an der neuen Wertschöpfungskette könnten Mittel frei werden, um bessere Haltungsbedingungen zu schaffen. Dies könnte dazu beitragen, den Anteil der ökologischen Landwirtschaft zu steigern und insgesamt nachhaltiger zu produzieren.
Werden Landwirte sich in das Thema Kulturfleisch einbinden lassen?
Die Landwirte werden sehen wollen, ob sie Vorteile von dieser Produktionsweise haben. Schließlich müssten sie umstrukturieren und investieren. Uns ist es auf jeden Fall wichtig, mit den Landwirten zusammenzuarbeiten. Es gilt, Vertrauen aufzubauen und die Menschen mitzunehmen. Ich bin dafür, die Landwirte einzubinden und dagegen, Dinge auf radikale Weise zu verändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Landwirte Interesse daran haben, mitzumachen.
Würden Sie persönlich komplett auf kultiviertes Fleisch umsteigen?
Ich kann diese Frage nicht so einfach beantworten. Grundsätzlich esse ich ohnehin nicht so viel Fleisch, weil sich mein Bedürfnis danach in Maßen hält. Ich denke, ich würde meinen alltäglichen Bedarf aus kultiviertem Fleisch decken und vielleicht ab und an, zum Beispiel zu Feiertagen und beim geselligen Beisammensein, hochqualitatives Fleisch essen.
Wollten Sie schon immer Tierärztin werden? Und wie ist Ihr beruflicher Werdegang verlaufen, der Sie schließlich an das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) geführt hat?
Ich entdeckte meinen Berufswunsch, Tierärztin zu werden, bereits im Alter von fünf Jahren auf dem Bauernhof meines Onkels – einen Traum, den ich später tatsächlich verwirklichte. Geboren wurde ich 1960 in Wolgast, einer Stadt im Nordosten Deutschlands, die auch als „Tor zur Insel Usedom“ bekannt ist.
Nach meinem Abitur absolvierte ich zunächst ein einjähriges Pflichtpraktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, einem so genannten Volkseigenen Gut (VEG). Diese Betriebe waren staatliche landwirtschaftliche Großbetriebe in der ehemaligen DDR. Anschließend studierte ich an der Humboldt-Universität zu Berlin (HUB) Veterinärmedizin und schloss mein Studium mit einem Diplom ab, das damals den Titel „Diplomveterinärmediziner“ verlieh.
Meine wissenschaftliche Karriere begann ich im Fachbereich Physiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo ich auch promovierte. Meine Doktorarbeit befasste sich mit dem Energiestoffwechsel und Lernen bei Tieren. Später habilitierte ich mich an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über zellulären Magnesiumtransport. Zusätzlich erwarb ich den Titel Fachtierärztin für Veterinärphysiologie und absolvierte ein Studium der Hochschulpädagogik.
Im Zuge der Wende und der damit verbundenen Fusion der veterinärmedizinischen Fakultäten wechselte ich an die Freie Universität Berlin. Dort begann ich, mich intensiv mit Zellkultur zu beschäftigen, wobei ich mich zunächst auf Zellen des Magen-Darm-Traktes und Transportprozesse von Mineralstoffen, insbesondere Magnesium, konzentrierte. Später erweiterte ich meine Forschung auf Euter-, Herzmuskel-, Blut- und Leberzellen.
Seit 2004 arbeite ich am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN), wo ich zunächst in der Ernährungsphysiologie tätig war und später zur Muskelbiologie wechselte. Im Laufe meiner Karriere habe ich mich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigt. Neben meiner jetzigen Forschung gehörten dazu beispielsweise Untersuchungen darüber, wie Tiere ihre Nahrungsaufnahme regulieren. Ein bedeutender Durchbruch war die Entdeckung des ersten Magnesiumaustauschers, eines Proteins, das Magnesium im Austausch gegen Natrium aus Zellen transportiert. Diese Entdeckung konnte wichtige Erkenntnisse für das Verständnis der Parkinson-Krankheit liefern.
Weitere Forschungsschwerpunkte waren die Entwicklung von Methoden zur Reduzierung des Methanausstoßes bei Rindern, die Untersuchung des Energiestoffwechsels von Hochleistungskühen sowie die Erforschung von Möglichkeiten zur Früherkennung von Stoffwechselstörungen bei Nutztieren.
Als Mehrfacherfinderin freue ich mich, wenn die Erkenntnisse meiner Forschung auch in die Praxis umgesetzt werden.
Frau Röntgen, wir bedanken uns für das Gespräch.
Dieses Interview wurde geführt und zur Verfügung gestellt von der Journalistin Susanne van Veenendaal. Im Rahmen eines Buchprojekts über kultiviertes Fleisch, das den Titel „Die neue Fleischkultur – Warum Cultured Meat gut für Tier, Mensch und Umwelt sein kann“ tragen wird, an dem Susanne van Veenendaal gemeinsam mit Christoph Werner und Bastian Huber von cultured-meat.shop arbeitet, spricht sie mit verschiedenen deutschen Unternehmen, Forschern und Initiativen der Branche.